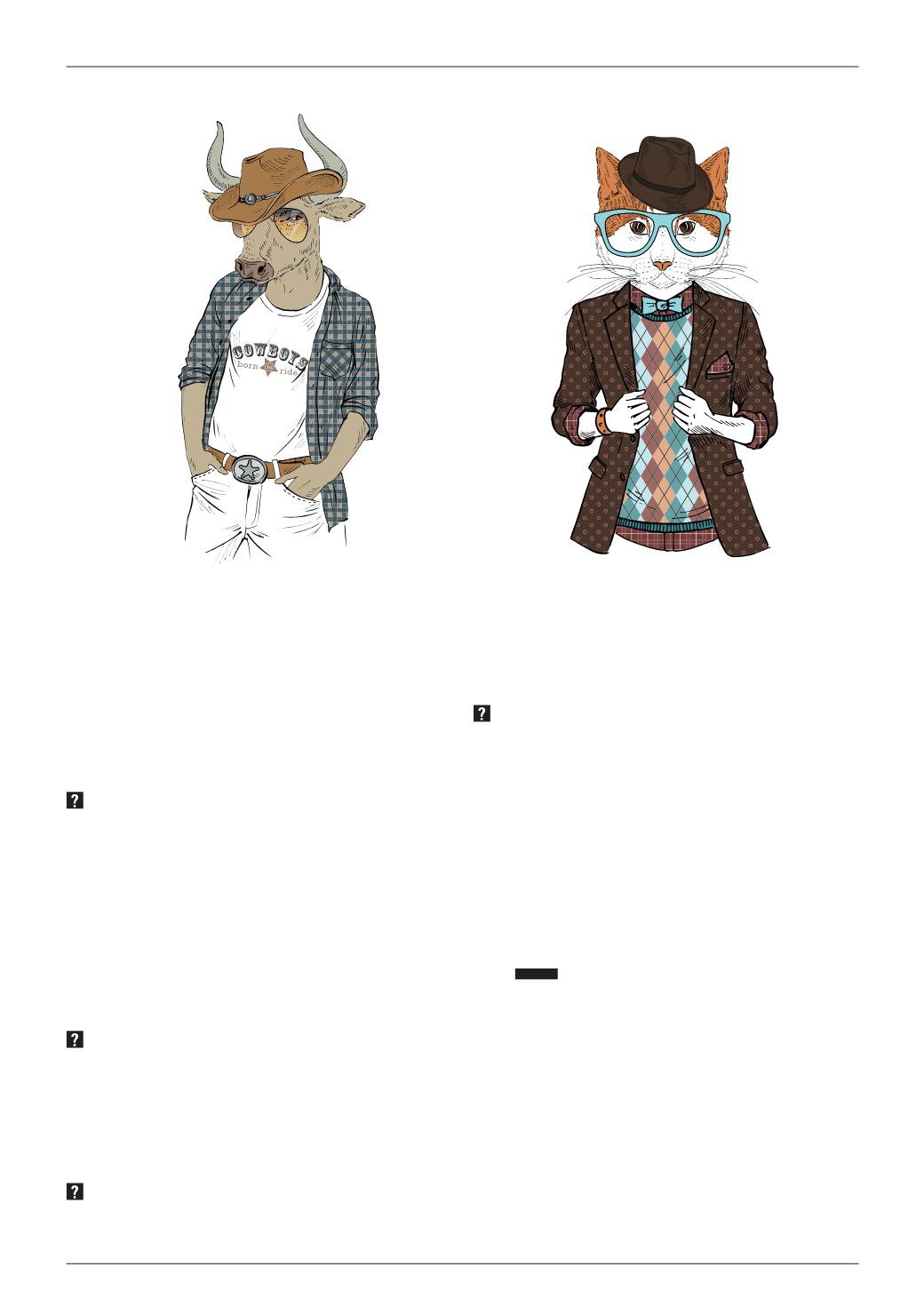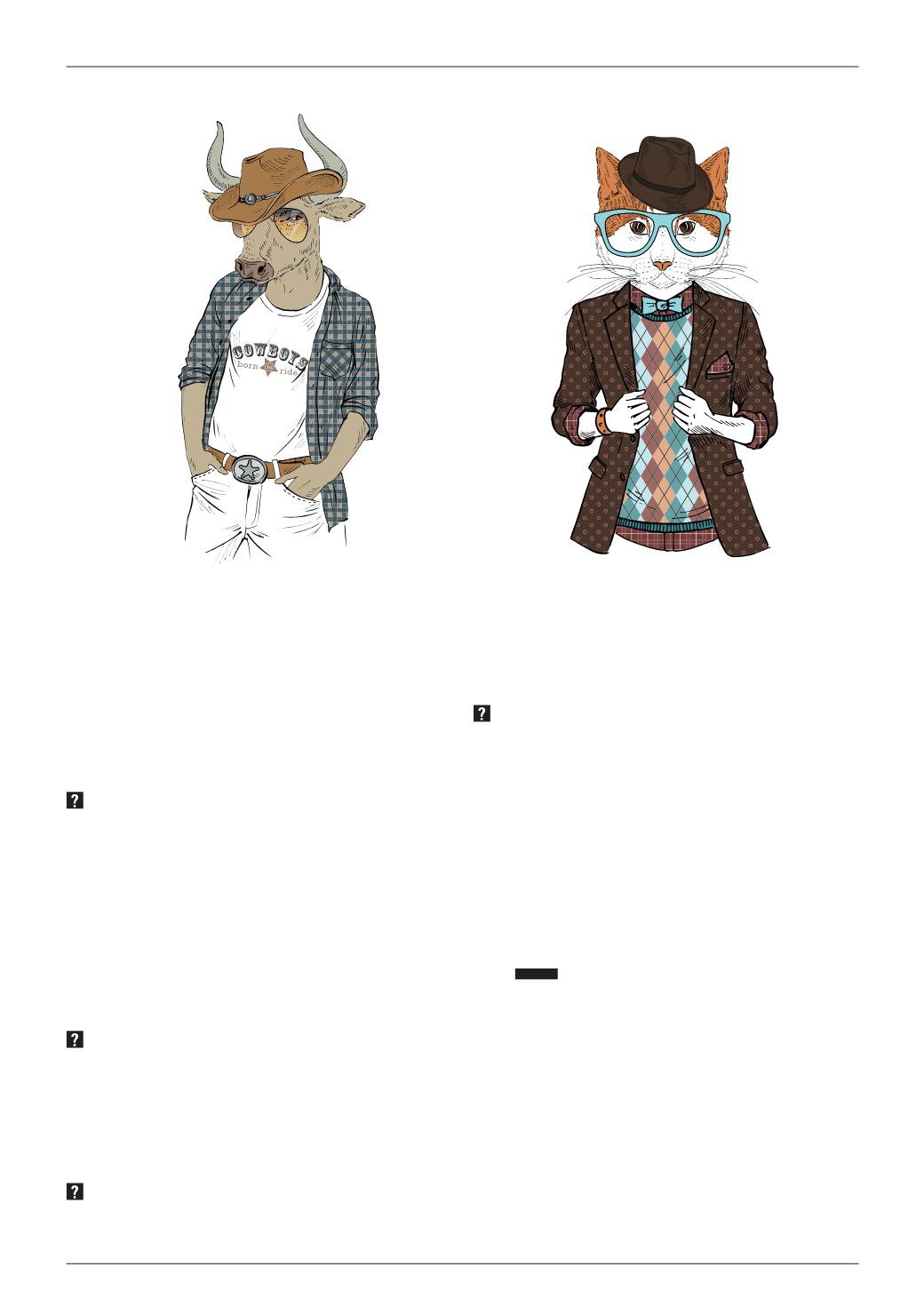
Zum
Hofe
31
„Dazu fällt mir eine interessante US-Studie ein. Sie stellte
die Frage: Wenn Sie auf eine einsame Insel müssten und
dürften nur ‚Einen‘ mitnehmen, wer wäre das? 57 Prozent
der Befragten antworteten: mein Haustier. Für mich folgt
daraus: Die Haltungs- und Nutzungsformen der Landwirt-
schaft betrachten Bürger von Industrienationen aus der Per-
spektive ‚Tiere als Familienmitglieder und Partner‘.“
„Wer über Tiere spricht, macht den Menschen zum
Thema“, das schrieben Sie in einem Ihrer Fachartikel.
Könnten Sie erklären, was sich hinter dieser Gleichung
verbirgt?
„Egal ob ich über meinen Computer nachdenke oder über
meinen Hamster: Ich beginne immer bei mir als Erkenntnis-
subjekt. Von ihm gehe ich aus. Deshalb liegt vielen auch mehr
an Menschenaffen als an Regenwürmern. Der Gorilla ist uns
– mutmaßlich – ähnlich, er ist intelligent. Aber folgt daraus
ein Recht, ihn stärker zu schützen als Fische oder Mäuse?“
Was folgt daraus für Sie als Ethiker?
„Zurückhaltung. Wir dürfen nicht vorschnell darin sicher
sein, was uns da gegenübertritt und welche Ansprüche es
an uns richtet. Wir können in kein Tier hineinschauen. Wir
schauen es immer nur an – mit unserer menschlichen Per-
spektive, die sich nie ganz heraushalten lässt.“
Und das wiederum bedeutet?
„Tiere sind kulturell geschaffene Wesen. Das Tier an sich
gibt es nicht. In unseren Wahrnehmungen und Vorstellun-
gen, die historischen Veränderungen unterliegen, taucht es
als das auf, was wir jeweils aus ihm machen.“
Was geben Sie nun einem Landwirt oder einem Veteri-
när an die Hand, der sich mit Ethik auseinandersetzt, der
Orientierung sucht?
„Wo immer für ihn praktische Möglichkeiten bestehen, Tier-
wohl voranzubringen, sollte er sie ergreifen. Stößt er an
Rahmenbedingungen, die Verbesserungen gar nicht erst zu-
lassen, dann verschiebt sich die Verantwortung auf eine
neue Ebene: Tierwohl ist auch eine gesellschaftliche Auf-
gabe. Verantwortungsvolle Bürger müssen sich die Frage
stellen, ob und wie die Rahmenbedingungen für Landwirt-
schaft weiterentwickelt werden sollen. Auf die Veterinärme-
diziner kommt hier eine besondere und eine große Aufgabe
zu.“
Prof. Dr. Herwig Grimm lehrt seit 2011 als Professor für Phi-
losophie und „Ethik der Mensch-Tier-Beziehung“ an der
Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Universi-
tät Wien.